| |
| | | blättern ( 1 / 22 ) |  |
| |
Das Denkmuster, nach dem der Marxist die Welt begreift |
| |
Die paradigmatischen Grundlagen der Marxschen ökonomischen Theorie |
| |
|
|
|
Alle wichtigen Lehren oder Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft - heute sagt man einfach Theorien - sind Produkte der europäischen Moderne, genauer gesagt ihrer rationalistischen Philosophie. Nach dieser Philosophie sollte sich die ganze Realität mit einer bestimmten Zahl von universal und zeitlos geltenden Prinzipien bzw. logischen Mustern erklären lassen. Dieser rationalistischen Auffassung folgend, muss eine jede Wissenschaft ein System, d. h. ein nach bestimmten Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse sein (Kant). Eine solche Auffassung von Wissenschaft scheint uns heute so selbstverständlich, als ob dies schon immer so gewesen sein müsste. Das trifft natürlich nicht zu, im Gegenteil. Diese Auffassung ist eine sehr junge Errungenschaft des menschlichen Geistes und zugleich eine radikale Wende in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. In der vormodernen Zeit hat man mit Lehren oder Doktrinen etwas andres gemeint, nämlich ein loses Bündel aus Erfahrungen, Überlieferungen, Wahrnehmungen, Mythen, Empfindungen, Intuitionen, … zusätzlich auch noch mit Wünschen, Erwartungen und Werten durchwoben, welche von einer Autorität ausgewählt, zusammengefügt und zu ewigen Dogmen erklärt wurden. Folglich galten neue Erkenntnisse oder Praktiken als wahr und richtig, wenn sie im Einklang mit diesen Dogmen standen, worüber ebenfalls die Autoritäten zu entscheiden hatten.
Die rationalistische Denkweise der modernen Wissenschaften hat sich sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht als dermaßen erfolgreich erwiesen, wie man es früher nicht einmal träumen konnte. Mit ihr ließen sich umfangreiche und detaillierte Kenntnisse über die Natur gewinnen, die sich in der Praxis sehr einbringlich anwenden ließen. Dank ihnen konnte die Produktivität dermaßen schnell und kräftig steigern, wie es in der Geschichte noch nie zuvor der Fall war. Der frühmoderne Rationalismus schien deshalb auf der ganzen Linie gesiegt zu haben. Doch dann geschah etwas Unerwartetes.
Gerade in den erfolgreichsten (Natur-)Wissenschaften hat sich herausgestellt, dass sich neue Bereiche der Realität bzw. neue empirische Tatsachen nur mit neuen Denkweisen erschließen lassen, die aber mit den gewohnten Denkweisen kein widerspruchsfreies Ganzes bilden können. Seitdem wissen wir, dass man logisch nicht auf nur eine einzige Weise denken kann. Dies war das endgültige Ende der maximalistischen Ansprüche des neuen Rationalismus und seiner Vorstellung von einem geschlossenen Erkenntnissystem, das für die ganze Welt gültig wäre. Das rationalistische Wissen zerfiel in partielle und autonome Denksysteme, die untereinander nicht mehr kommensurabel („kompatibel“) sind. Heute bezeichnet man sie als wissenschaftliche Paradigmen. Setzt sich ein neues Paradigma in einer Wissenschaft durch, spricht man von einer erfolgreichen wissenschaftlichen Revolution oder vom Paradigmenwechsel (Thomas Kuhn).
In den Sozialwissenschaften will man trotzdem immer noch nichts von „wissenschaftlichen Revolutionen“ bzw. „Paradigmenwechseln“ wissen. Vor allem in der Wirtschaftswissenschaft nicht, die übrigens wie kaum eine andere in den letzten zwei Jahrhunderten theoretisch steril und praktisch erfolglos blieb. Deshalb habe ich es für notwenig gehalten, am Anfang dieses thematischen Bereichs mit dem Schwerpunkt Das Elend der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung: ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung:
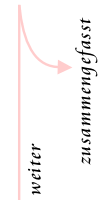 |

Wie bereits angedeutet, haben die Philosophen am Anfang der Moderne von der Ratio zu viel erwartet. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist die reale Welt zu komplex für die logischen Erklärungssysteme, die sich der homo sapiens ausdenken kann. Wir können uns zwar vorstellen, dass im Kopf des Allmächtigen das ganze Universum, bis ins letzte Detail, ein einziges, in sich schlüssiges logisches System sein kann, aber der Kopf des Menschen ist für ein solches System offensichtlich zu klein. Dies hätte eigentlich schon deutlich sein müssen, als sich feststellen ließ, dass die neu entstandenen Wissenschaften ihre eigenen Theorien und Methoden - jede Wissenschaft für sich allein - entwickelten, um den von ihnen abgegrenzten kleinen Bereich der Wirklichkeit zu erforschen. Wenn eine universelle Wissenschaft möglich wäre, müssten sich die speziellen Wissenschaften um solche eigenen Theorien und Methoden nicht kümmern.
Das alles wollte man aber vorerst übersehen und die nahe liegenden Schlüsse nicht ziehen. Es ist aber verständlich. Als die modernen Wissenschaften gerade entstanden sind, war es nicht abwegig eine Zeitlang abzuwarten und hoffen, dass zumindest innerhalb dieser speziellen Wissenschaften immer gleiche Denkweisen gelten würden, so dass die Wissenschaftler ihre Fortschritte immer weiter, sozusagen linear und kumulativ, machen würden. Es kam aber anders. Allmählich wurde es immer deutlicher, dass sich auf den gleichen analytischen Grundlagen doch nicht immer weitere Fortschritte machen lassen. Die Theorien sind sozusagen nicht dermaßen belastbar, dass man auf sie immer weiter und höher aufbauen kann. Wie oben ebenfalls angedeutet, hat man diese schmerzhafte Erfahrung gerade in der erfolgreichsten Naturwissenschaft, in der Physik, zuerst gemacht: Man erinnert sich an die Relativitätstheorie von Einstein, die schon einiges in der Welt der klassischen Physik durcheinander gebracht hat. Die Quantenphysiker danach haben dann so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Danach wurde es unmöglich, sich vor der befürchteten Konsequenz zu drücken, dass es nicht einmal in den speziellen Wissenschaften möglich ist, rationale Grundlagen zu schaffen, die für alle Zeiten gültig wären. Das Alte muss von Zeit zu Zeit geopfert werden, weil es mit dem Neuen nicht kommensurabel ist. Der geschlossene Rationalismus vom Anfang der Moderne, ich bezeichne ihn auch als Monologizismus, war also eine Anmaßung. Er war es auch noch in einer anderen Hinsicht.
Unterstreichen wir noch einmal, dass es die praktischen, also im strengsten Sinne empirischen Erfolge waren, die bei den rationalistischen Philosophen der Moderne maximalistische Hoffnungen weckten, sie würden die ganze Realität in ein einzigeslogisch widerspruchsfreies System packen können. Gerade diese empirischen Erfolge haben die unvorsichtigen Rationalisten am Anfang der Moderne zu dem gewagten Gedanken verführt, dass das „richtige“ Denken mit der Realität identisch, oder zumindest sozusagen ein genauer Spiegel des Seienden wäre. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es nicht einmal im Rahmen einer einzelnen Wissenschaft eine für alle Zeiten richtige Denkweise gibt, kann man sich nun sicher sein, dass das rationale Denken die Realität, wie sie „wirklich ist“, also das sogenannte „Ding an sich“ (Kant) nie erreichen kann. Seitdem lässt sich nicht mehr daran zweifeln, dass sich die rationalen Schlussfolgerungen nur auf die Oberfläche der Realität beziehen können, also auf das, was unseren - nicht besonders empfindlichen und präzisen - Sinnen zugänglich ist. Das nennt man Tatsachen. Für einen Philosophen kann dies enttäuschend wenig sein, aber für die Existenz des Menschen reicht ein solches Wissen - über die Tatsachen - doch völlig aus. Die Wissenschaften können also auch nach dem Zerfall des alten geschlossenen Rationalismus weitermachen wie bisher, nur müssen sie sich der Notwendigkeit bewusst sein, dass ihren neuen Durchbrüchen, also der Eroberung von neuen „Schichten“ der Tatsachen, immer eine Änderung der Denkweise vorausgehen muss, also ein neues Paradigma. Da stellt sich die Frage, wann eine Wissenschaft für ein neues Paradigma reif ist und wie der Paradigmenwechsel vor sich geht.
Zu einem Paradigma gehört vor allem eine bestimmte Zahl von Annahmen, Prinzipien und Methoden, welche die Wissenschaftler zur Grundlage - zur axiomatischen Basis - ihrer Forschung machen. Erst diese Grundlagen machen eine systematische Forschung - und die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern - möglich. Als ein logischer Rahmen bestimmen sie, was empirisch beobachtet und erforscht werden soll, welche Ergebnisse als relevant gelten können und wie diese interpretiert werden dürfen. Die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft sind immer sehr abstrakt. Als solche sind sie sozusagen ziemlich leer oder nackt - und haben schließlich kaum einen Bezug zu den empirischen Tatsachen, was einen sehr wichtigen theoretischen Vorteil hat. Als solche lassen die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft viele freie analytische Räume für Generierung und Implementierung neuer Begriffe und logischer Muster. Solange die Forschung diese freien Räume mit Inhalten füllt, was in der ursprüngliche Phase der Entwicklung eines neuen Paradigmas der Fall ist, spricht man von „normaler Wissenschaft“ (Thomas Kuhn).
Es gibt aber nur bestimmte Typen von Begriffen und Zusammenhängen, die sich ohne Verletzung der logischen Konsistenz im Rahmen eines Paradigmas analytisch generieren und implementieren lassen, mit anderen Typen geht das jedoch nicht. Dies macht die „normale Wissenschaft“ hilflos, wenn sie in ihrer Forschung auf neue Tatsachen oder neue Zusammenhänge zwischen den Tatsachen stößt. Für sie bietet das gültige Paradigma keinen freien Raum. Diesen Stand hat die Forschung erreicht, wenn die Wissenschaftler von Anomalien oder Paradoxen sprechen. Was lässt sich dann tun? Um die „normale Wissenschaft“ bzw. das alte Paradigma zu retten, greift man zuerst nach Ad-hoc-Hypothesen. Man erhofft sich, mit ihnen würde man den logischen Rahmen, innerhalb dessen das Paradigma noch seine Gültigkeit behält, breiter machen können. Das kann aber nicht gelingen. Die Ad-hoc-Hypothesen bedeuten keinen wirklichen wissenschaftlichen Fortschritt, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Durch sie wird eine Wissenschaft beliebig.
Diese Beliebigkeit einer durch Ad-hoc-Hypothesen überfrachteten Wissenschaft ist sogar von einem Laien leicht zu erkennen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist zerrissen. Sie bietet eine große Zahl von theoretisch „richtigen“ Vorschlägen, um ein konkretes Problem zu lösen, die im Nachhinein alle scheitern, und eine große Zahl von „richtigen“ Prognosen über die Zukunft, die sich alle als falsch erweisen. Die sich häufenden Paradoxe und das folgende Wetteifern der Fachleute um bessere Ad-hoc-Hypothesen ist ein sicheres Zeichen, dass eine Wissenschaft degeneriert (Imre Lakatos). Dann bleibt einer seriösen Wissenschaft nichts anderes übrig, als sich von der alten paradigmatischen Grundlage zu verabschieden und sich nach einer völlig neuen umzuschauen. Hat man sie gefunden, kann der nächste Paradigmenwechsel stattfinden. Das alte Paradigma wird aus der Wissenschaft entweder gänzlich verstoßen (Thomas Kuhn) oder von dem neuen eingewickelt (Gaston Bachelard). |
 |
| |
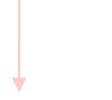 |
Sind die wichtigsten ökonomischen Lehren und Doktrinen - zumindest die bekanntesten, also jene mit zahlreichen treuen Anhängern - wirkliche wissenschaftliche Paradigmen? Nach meiner festen Überzeugung genügt nur die frühliberale Lehre der natürlichen Ordnung den strengen Ansprüchen eines wirklichen wissenschaftlichen Paradigmas. Alle späteren Versuche, diese frühliberale Lehre wesentlich nachzubessern oder sie zu ersetzen, greifen nicht weit genug. Sie sind keine richtigen Paradigmen, weil ihnen entweder ein richtiger Bezug zur Realität fehlt (Marxismus, Neoliberalismus) oder weil ihre analytischen Grundlagen zu dürftig sind (Ordoliberalismus, Keynesianismus). Aber wir müssen uns mit dem abfinden, was uns zur Verfügung steht. Angesichts der unbestrittenen Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaft noch erschreckend erfolglos und rückständig ist, können wir auch nicht so streng mit ihren „Paradigmen“ sein.
Ist der Marxismus ein wissenschaftliches Paradigma?
Die Marxsche Philosophie rühmt sich eine universale „dialektische“ Erklärung der ganzen Realität zu sein. Sie erklärt in der Tat sowohl die Natur als auch die Gesellschaft - und schließlich auch die Wirtschaft - mit denselben Prinzipien und logischen Mustern, die man als „dialektische Methode“ bezeichnet. Hätte sich im nachhinein nicht herausgestellt, dass diese Methode eine wertlose Spekulation ist und hätte Marx nicht mathematische Fehler gemacht/begangen, aus denen er zu theoretisch und empirisch völlig falschen Schlussfolgerungen gelangt ist, wäre seine ökonomische Lehre sogar ein Paradigma im doppelten Sinne: im philosophischen und ökonomischen.
Die Erklärung der Natur und der Gesellschaft aus einer kleinen Zahl allgemeinen und zeitlosen Prinzipien war schon immer eine faszinierende Herausforderung. Die von Marx vorgeschlagene Lösung dieses sehr alten philosophischen Problems war in einer Hinsicht ein einzigartiger Erfolg. Lassen wir die Bibel beiseite, weil sie ein kollektives Werk ist, gelang es Marx mit seinen Schriften so viele Anhänger zu überzeugen und zu gewinnen, wie keinem in der ganzen Geschichte. Nur Mohamed kann sich mit ihm messen, aber zeitlang war auch er ihm weit unterlegen.
Die „dialektischen Prinzipien“ der Erklärung der Natur und der Gesellschaft hat Marx von den deutschen klassischen idealistischen Philosophen übernommen - hauptsächlich von Hegel. Er hat sie nur anders mit den Inhalten gefüllt. Zum wichtigsten Prinzip der Dialektik gehört bestimmt das „Gesetz“ des Übergangs von Quantität zu Qualität. Dieses „Gesetz“ ist der tragende Pfeiler seiner ganzen ökonomischen Lehre oder Doktrin. Mit ihm wollte er die kapitalistische Wirtschaft erklären. Genauer gesagt, er wollte die angeblichen Entwicklungstendenzen aufdecken, die diese Wirtschaftsform unausweichlich zum Zusammenbruch führen würden. Im Grunde war Marx nie daran interessiert, die Funktionsweise der Marktwirtschaft zu erklären und schon gar nicht ihre Probleme zu lösen. Er wollte nur endgültig nachweisen, dass sich diese gar nicht beseitigen lassen, so dass die ganze Marxsche ökonomische Theorie nur eine Kritik der kapitalistischen Wirtschaft (und Gesellschaft) ist.
Gegen die Kritik der Marktwirtschaft wäre nichts einzuwenden, wenn Marx darüber hinaus auch etwas Konkretes gesagt hätte, was nach der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus kommen würde. Statt dessen, hat er uns nur mit wenigen, in seiner Zeit weit verbreiteten Platituden abgespeist. Ohne wenn und aber lässt er uns unter anderem wissen, dass es in der neuen Wirtschaftsform kein privates Kapital geben wird. Würde dies aber nicht schon von zahlreichen Sozialisten seiner Zeit - und sogar noch früher - behauptet? Und natürlich war Marx nie müde zu behaupten, dass das die Zukunft das Rech der Freiheit sein wird. Haben dies die marktradikalen Liberalen nicht schon immer behauptet?
Was war also Marx? Er war nur ein Kritiker aber kein Schöpfer. Auch darin erkennen wir in ihm einen echten großen deutschen Philosophen. Die deutschen Philosophen waren nie richtige Wissenschaftler, auch wenn sie immer den Mund voll von der Wissenschaft hatten. Ihre „dialektische Methode“, weil sie (unter anderem) nur Hohn und Spott für die empirischen Tatsachen übrig hat, war sogar eine extrem antiwissenschaftliche Methode - eine Spinnerei. Deshalb war auch Marx nie ein Wissenschaftler. Sein Vorhaben als Ökonom bestand lediglich darin, die englische klassische Wirtschaftstheorie (Politische Ökonomie) im Geiste der deutschen klassischen Philosophie, besser gesagt Metaphysik oder gar Mystik, umzuinterpretieren.
Ein illustratives Musterbeispiel über die Funktionsweise der dialektischen Methode
Die Entwicklungstendenzen des Kapitalismus, also seine Geschichte und sein Schicksal, sollte nach den dialektischen Gesetzen eine Quantität bestimmen. Marx wurde zum Ökonom, weil er diese Quantität in der Ökonomie gefunden hat. Sie heißt Kapital, wie auch der Titel seines Hauptwerks. Aber bevor wir etwas mehr über diese ökonomische Quantität sagen, ist es wichtig die dialektische Methode des Übergangs von Quantität zu Qualität näher kennen zu lernen. Wie gesagt, dieses Muster sollte als Gesetz für die ganze Realität gelten, so dass das folgende Beispiel, die bekannte Urknalltheorie aus der Physik, nicht nur die Problematik gut illustriert, sonder auch eine Symbolische ausstrahlt.
Die Urknalltheorie, wonach das ganze Universum vor mehr als 13 Milliarden Jahren entstanden ist, dürfte sogar dem Leser der gelben Presse in den Grundzügen bekannt sein. Der Urknall - englisch Big Bang, wörtlich also großer Knall - bezeichnet aber keine „Explosion“ in einem bestehenden Raum, sondern die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität. Am Anfang gab es also Nichts, nicht einmal den Raum und die Zeit, sie sind erst nach dem Urknall entstanden, so dass das Universum erst danach immer weiter expandieren konnte. Der Raum und die Zeit sind also seitdem qualitativ unverändert geblieben, sie verbreiten sich nur quantitativ immer weiter. Mit der Materie sieht es aber ganz anders aus. Sie entwickelte sich qualitativ zu immer komplizierteren Formen.
Schon 10 s nach dem Urknall vereinigten sich Protonen und Neutronen durch Kernfusion zu ersten Atomkernen. Diesen Prozess bezeichnet man als primordiale Nukleosynthese. Zuerst haben sich nur leichte Atome gebildet, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Alle schwereren Elemente entstanden erst später im Inneren von Sternen. Die elementare Struktur des Universums ist seitdem atomar. Das haben schon die antiken Philosophen herausgefunden. Es ist erstaunlich, dass sie schon vor mehr als zwei Jahrtausenden auf eine solche Idee kommen konnten, weil die Atome nicht sichtbar sind. (Die Atome lassen sich natürlich auch heute nicht sehen, aber alles spricht dafür, dass unsere Kenntnisse über sie richtig sind.) Diese Philosophen haben angenommen, Atome seien sozusagen kompakte Klumpen aus fester Materie und nicht teilbar. Beides hat sich als falsch erwiesen. Ernest Rutherford entdeckte (1906), dass Atome nicht massiv, sondern aus Kern und Hülle zusammengesetzte Systeme sind. (Damit ist die Bezeichnung "Atom" im Grunde falsch. Sie wurde aber beibehalten.) Aus dem Experiment leitete Rutherford bis 1911 die Größe eines Atoms, also der Atomhülle, und der Größe des Atomkerns ab.
Das einfachste Atom ist das Wasserstoffatom. Seine Atomhülle hat nur ein Elektron und sein Kern nur ein Materialteilchen, das positiv geladen ist, genannt Proton. Später hat James Chadwick (1932) etwa gleich große Materialteilchen entdeckt wie das Proton, die aber keine elektrische Ladung besitzen, sogenannte Neutronen. Weitere Experimente der Atomphysiker haben gezeigt, dass ein zusätzliches Proton in dem Atomkern zur Bildung eines chemisch völlig neuen Elements führt.
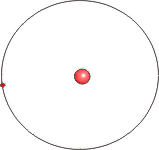 |
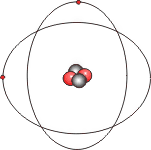 |
|
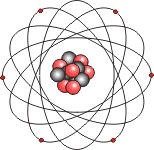 |
|
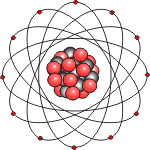 |
|
| Wassserstoff (H) |
Helium (He) |
. . . |
Kohlenstoff (C) |
. . . |
Aluminium (Al) |
. . . |
| 1 Proton |
2 Protonen |
|
6 Protonen |
|
13 Protonen |
|
Man kann hier in der Tat sagen, dass Quantität, also die Zahl der Protonen, zu einer neuen (chemischen) Qualität führt. Allerdings gilt dies nur für Protonen. Warum dasselbe nicht auch mit Neutronen klappt, bleibt natürlich unerklärt, aber lassen wir das jetzt, sonst könnten wir die „dialektische Methode“ gleich vom Tisch kehren. Noch eine Eigenschaft des Übergangs von Quantität zu Qualität fällt auf. Eine mittlere Position gibt es nicht. Die Übergänge finden momentan statt. Deshalb spricht man bei der „dialektischen Methode“ üblicherweise nicht vom Übergang, sondern vom Umschlag von Quantität in Qualität.
In der Zeit als Marx an seiner Metaphysik der Geschichte bastelte, kannte man die Struktur der Atome nicht, so dass man die Richtigkeit des quantitativen Umschlags in der Chemie zu sehen meinte und dies als Beweis nutzte. Außerdem ist die Zahl der Elemente (und ihrer Isotope) auf wenige Hunderte begrenzt, die Zahl der chemischen Substanzen lässt sich nicht einmal abzählen, so dass sich in der Chemie viele Beispiele finden lassen, auf die sich die dialektische Methode berufen konnte. Nehmen wir eine der am meisten verbreitetsten chemischen Substanzen: Wasser. Diese Flüssigkeit hat in der Tat völlig andere Eigenschaften als zwei Gase, Wasserstoff und Sauerstoff, aus denen sie sich bildet. Im gewissen Sinne kann auch hier vom Umschlag von Quantität in Qualität gesprochen werden. In der Dialektik der Natur schreibt Friedrich Engels, der lebenslang treuste Freund von Marx und sein erster begeisterter Anhänger:
„Das Gebiet jedoch, auf dem das von Hegel entdeckte Naturgesetz [vom Umschlag von Quantität in Qualität] seine gewaltigsten Triumphe feiert, ist das der Chemie. Man kann die Chemie bezeichnen als die Wissenschaft von den qualitativen Veränderungen der Körper infolge veränderter quantitativer Zusammensetzung.“ 
Wie sieht es aber mit der Entwicklung der Gesellschaft aus? Was ist dort die geheimnisvolle Quantität, die in die Qualität umschlägt? Wie bereits angedeutet, ist diese Quantität das Kapital, oder noch genauer gesagt die Produktivität. Weil auch hier Marx nichts Originelles leistet, kann eine kurze historische Bestandaufnahme sehr hilfreich sein.
Man findet schon beim Ökonomen Anne R.-J. Turgot (1727-1781) die klaren Aussagen darüber, dass die Anhäufung von Kapital zur Steigerung der Produktivität führt. Auch Adam Smith hat diese Auffassung (mit kleiner Einschränkung) übernommen und seitdem, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, galt sie als eine Selbstverständlichkeit, die nicht einmal der Prüfung bedarf. Jedem war nämlich klar - abgesehen von seltenen Ausnahmen (z.B. Ricardo) -, dass die produktiveren Maschinen teuerer sind, so dass man daraus schlussfolgerte, dass sie auch mehr Kapital in sich verkörpern. Diesen ökonomischen Irrtum hat dann Marx zu einem metaphysischen Unsinn hochstilisiert: Die Kapitalmenge bzw. die Produktivität sei die Quantität, welche die gesellschaftliche Entwicklung vorantreibt. Nach dieser „Entdeckung“ der Quantität schien es Marx auf einmal, als hätte er den Schlüssel zur Erklärung der ganzen Geschichte in der Hand. Wenig Kapital bzw. die niedrige Produktivität ergibt die Sklavenordnung, etwas mehr den Feudalismus und noch mehr den Kapitalismus. Nachdem der Kapitalismus nicht mehr fähig sein werde, zu akkumulieren, würde er durch eine neue Wirtschaftliche Ordnung ersetz werden: durch den Kommunismus. Aber erst nach der Revolution. Somit kommen wir zum nächsten „dialektischen Gesetz“: dem Kampf der Gegensätze.
Es ist bekannt, wie Hegel - Marx wichtigster Lehrer - vom Krieg besessen war. „Die Geschichte“, so die bekannte Redewendung dieses berühmten deutschen Philosophen, „ist ein Schlachthof“. Marx versteht unter dem Kampf der Gegensätze nicht Kriege, sondern Revolutionen. Die Geschichte ist zweifellos sehr reich an Kriegen und Revolutionen, was sollte aber unter dem Kampf der Gegensätze in der toten Natur verstanden werden? Kämpft ein Wasserstoffatom wirklich mit dem nächsten Proton, der mit ihm verschmelzen will, damit sie zum Helium werden? Na ja, nach dem, was wir aus der Atmphysik wissen, braucht man in der Tat viel Energie, um dem Wasserstoffatom ein zusätzliches Proton aufzuzwingen. Sollte man dies als Kampf der Gegensätze verstehen? Vielleicht ist dies nur die Frage der Phantasie. Wie ist etwa das Verhältnis zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff, bevor sie sich zum Wasser vereinigen? Man hat den Endruck, dass dies sozusagen sehr „bereitwillig“ geschieht: ein Funke reicht schon. Ob man auch hier von einem Kampf reden kann? Dazu würde man viel Phantasie brauchen.
Gehen wir aber auch diesmal nicht so weit. Was die historische Entwicklung der Gesellschaft betrifft, da spricht in der Tat vieles über den „Kampf der Gegensätze“. Neue gesellschaftliche Formationen, also neue sozioökonomische Qualitäten sind nicht selten durch Kämpfe oder Revolutionen entstanden. Aber nicht immer. Diese Trivialität ist aber das einzige, wo der Marxsche „historische Materialismus“ noch gewisse empirische Tatsachen hinter sich hat. Mit dem anderen dialektischen Gesetz, mit dem „Umschlag von Quantität in Qualität“ sieht es aber nicht besonders gut aus. Die Sklavenwirtschaft wurde z.B. durch die feudale Ordnung ersetzt, die nicht kapitalreicher bzw. produktiver war. Schlimmer noch. Einen kausalen Zusammenhang zwischen Kapitalmenge und Produktivität, gibt es nicht. Das wollen wir im Folgenden genauer erörtern.
|
|
|