| |
 |
zurück springen |
|
|
|
|
 |
|
| |
| |
4. Phase des ökonomischen Zyklus der Marktwirtschaft: Der Abschwung (Rezession) |
| |
Eins vorweg: Was tun wenn die alten Theorien (Paradigmen) versagen? |
| |
|
|
|
| |
|
Gerade weil es ein übergang zwischen inkommensurablen Dingen ist, kann Paradigmawechsel nicht Schritt um Schritt vor sich gehen. Er muss, wie der Gestaltwandel, auf einmal geschehen oder überhaupt nicht. |
|
| |
|
Thomas Kuhn, einer der bedeutendsten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts |
|
|
|
|
|
Vor etwa einem Jahrhundert galt es für die Wissenschaftler als selbstverständlich, dass das neue Wissen aus dem schon vorhandenen hervorkommen würde. Dies bedeutete zugleich, dass die bereits etablierten Wissenschaften auf festen Grundlagen stünden, auf die man nur immer weiter aufbauen sollte. Aber die Zweifel, dass dies doch nicht stimmen könne, wurden immer stärker. Gerade bei der Königin der Wissenschaften, der Physik, häuften sich im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert die Zeichen, dass der eingeschlagene Weg nirgendwo mehr hinführt. Erst als ihre Grundlagen am Anfang des 20. Jahrhunderts geändert bzw. ausgetauscht wurden, ließen sich neue Fortschritte machen. Seitdem hat man in den „harten“, also in den erfolgreichen Wissenschaften, vor allem in den Naturwissenschaften, kein Problem, über die Grundlagen zu sprechen und sie zu innovieren. In den „weichen“ Wissenschaften, also in den Sozialwissenschaften, hat man sich von dieser Erfahrung nicht beeindrucken lassen, in der Wirtschaftswissenschaft will man davon bis heute gar nichts wissen. Vor allem die Verfechter der neoliberalen Theorie lehnen es strikt ab, über die Grundlagen ihrer Wissenschaft zu diskutieren, geschweige denn über ihre Änderung, auch wenn die praktischen Misserfolge ihrer Theorie so offensichtlich und verhängnisvoll sind. Unter anderem kann die neoliberale Theorie die periodischen Krisen der Marktwirtschaft nicht erklären bzw. nicht einmal als Problem analytisch formulieren. Darum wird es uns im Folgenden gehen. Wie wir zeigen werden, liegt das an ihren Grundlagen. Sie müssen ausgetauscht werden, und wir bieten auch eine konkrete Lösung an, wie das geschehen kann.
Weil es sich um eine erkenntnistheoretische Problematik handelt, ist es angebracht, dass wir zuerst etwas über die Notwendigkeit der Grundlagenänderung bei den Wissenschaften im Allgemeinen sagen.
Der wissenschaftliche Fortschritt als Entwurf neuer Weltbilder (Modelle) im Kopf
Es ist nicht so, dass nur der Mensch etwas weiß. Auch Tiere verhalten sich in verschiedenen Situationen auf eine zweckrationale Weise, so dass es sich auch bei ihnen sagen lässt, dass sie etwas „wissen“. Ihr „Wissen“ steckt hauptsächlich, ihnen unbewusst, in ihren Instinkten, die sie geerbt haben. Bei höher entwickelten Arten können sich die Jungen ein wenig Wissen auch durch Lernen von den Eltern aneignen. Der Mensch hat noch eine weitere Möglichkeit, zu neuem Wissen zu gelangen. Er kann seine Vernunft oder Ratio zum Denken benutzen. Auf diese Weise ist der Mensch in den letzten Jahrtausenden zu einer erheblichen Menge von Erkenntnissen über sich und die Natur gelangt. Aber von wissenschaftlichen Erkenntnissen spricht man erst seit wenigen Jahrhunderten. Das kommt einem auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig vor. Könnte dies nur am Sprachgebrauch liegen?
Nein, es steckt mehr dahinter. Obwohl es sich bei dem vor- und nichtwissenschaftlichen Wissen genauso um Ergebnisse einer mentalen Anstrengung handelt, wie bei dem wissenschaftlichen, unterscheiden sich die Vorgehensweisen dieser zwei Denkweisen erheblich. Das vor- und nichtwissenschaftliche Wissen ist kaum etwas mehr, als ein Haufen von unabhängigen Erkenntnissen, die als einzelne Lösungen für konkrete praktische Probleme gedacht sind. Die Wissenschaft ist ganz anders aufgebaut. Um mit Kant zu sprechen, ist sie „ein System, d. h. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse“. Damit ist folgendes gemeint:
Die Wissenschaft wird zuerst abstrakt aufgebaut. Zuerst entsteht ihre gedankliche Substanz, indem man eine bestimmte Zahl von allgemeinen Regeln (Mustern) auf eine bestimmte Zahl von abstrakten Objekten (Begriffen) anwendet. Dabei ist es wichtig, dass sich die Ergebnisse nicht widersprechen. Deshalb kann die Zahl solcher Objekte und Regeln, die zu den Grundlagen der Wissenschaft aufgenommen wurden, beschränkt sein, und ihre Auswahl ist eine sehr langwierige und mühsame Angelegenheit. Sind aber die abstrakten Objekte und die allgemeinen Regeln einer Wissenschaft bekannt, ist ihre Anwendung eine relativ einfache Angelegenheit. Man braucht zwar eine bestimmte Ausbildung dazu, manchmal sogar eine umfangreiche und langjährige, aber es handelt sich um ein handwerkliches Beherrschen von bestimmten Routinen. Die Ergebnisse dieser Routinen gehören zwar zu einer gleichen Bauart, aber sie sind trotzdem zahl- und variationenreich. In dieser unendlichen Vielfalt der Ergebnisse eines zur Routine gewordenen Denkprozesses liegt die Antwort darauf, warum sich die Wissenschaften weit erfolgreicher alles andere erwiesen haben, was dem Menschen in der ganzen Geschichte eingefallen ist. In der vorwissenschaftlichen Zeit musste man nämlich für jeden konkreten praktischen Fall immer eine neue gedankliche Lösung finden, also immer ganz von vorne anfangen, in der Wissenschaft ist dies sozusagen automatisiert. Diese abstrakten potentiellen Lösungen brauchen dann nur noch praktisch getestet werden. Bei jenen, die sie sich empirisch bewährt haben, spricht man von wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Da stellt sich gleich die Frage, woher die zu den Grundlagen jeder Wissenschaft gehörenden Regeln und Objekte stammen und wie sie in das Denken des Menschen gelangen. Es ist eine schwierige Frage, mit der sich die Philosophen schon seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden quälen. Erwähnen wir nur, dass für die idealistischen Philosophen diese Regeln und Objekte Produkte der „reinen Vernunft“ sind, für die Empiriker stammen sie aus den Sinneseindrücken. Man ist sich also in der Sache immer noch nicht einig. Die Wissenschaftler sind hier aber in der angenehmen Lage, dass sie sich nicht entscheiden müssen.
Aus dem bereits Gesagten kann man folgern, dass man in der Wissenschaft zwei verschiedene Forschungsebenen unterscheiden kann. Auf einer wird nach brauchbaren abstrakten Objekten und allgemeinen Regeln gesucht, auf der anderen werden diese angewandt, und zwar zuerst rein abstrakt (theoretisch) und dann praktisch (empirisch). Im letzteren Fall spricht man von „normaler Wissenschaft“ (Thomas Kuhn). Aber irgendwann haben die Routiniers der „normalen Wissenschaft“ ihre Arbeit zu Ende gebracht. Sie haben schon (ziemlich) alles ausprobiert und herausgefunden, was sich auf der Basis der geltenden Grundlagen kreieren lässt. Sie haben die Grundlagen sozusagen ausgereizt. Dann drehen sich die Stückwerktechniker - die „normalen Wissenschaftler“ - nur im Kreise, ohne voran zu kommen. Die Wissenschaft „degeneriert“, um mit dem bekannten Erkenntnistheoretiker Imre Lakatos zu sprechen. Dann lässt sich nichts anderes tun, als an neuen Grundlagen zu arbeiten. Wie haben bereits erwähnt, dass dies am Ende des 19. Jahrhunderts in der Physik der Fall war. Dieser Fall ist nicht nur lehrreich, sondern hat mit der Wirtschaftswissenschaft mehr zu tun, als man sich denken kann, so dass es gerechtfertigt ist, etwas mehr darüber zu sagen.
Die erste richtige Wissenschaft war bekanntlich die klassische oder Newtonsche Mechanik (Isaac Newton 1643-1726). Es ist nicht schwer zu begreifen, warum die Erfolge dieser ersten Wissenschaft damals so viel Begeisterung ausgelöst haben. Unsere Sinne - vor allem die Augen - nehmen die Bewegung der Gegenstände in unserer nahen Umgebung auf, und auf den Grundlagen der Newtonschen „Gesetze“ ist es möglich geworden, solche Bewegungen endgültig zu erklären. Von diesem grandiosen Erfolg überwältigt, wurde man schnell unachtsam und übermütig; die Auffassung der Welt, wie sie aus dem Modell der klassischen Physik folgt, wurde auf das ganze Universum ausgeweitet. „Er ist der Glücklichste, das System der Welt kann man nur einmal erfinden“, schrieb der französische Gelehrte Joseph-Louis Lagrange über Newton. Was für eine Anmaßung und was für ein Irrtum! Heute wissen wir, dass die klassische Mechanik nicht mehr und nicht weniger erklärt hat als die Bewegung der Gegenstände, die sozusagen mittelgroß sind und die sich mit mittelgroßen Geschwindigkeiten bewegen. Je mehr sich die Physiker an kleinere (Mikrowelt) und größere Objekte (Makrowelt) heranwagten, desto klarer wurde es, dass sich mit dem partikel-mechanischen Modell von Newton nichts mehr erklären lässt. Was blieb den Physikern zu tun?
Es gab damals zwei Möglichkeiten, wie man weiter vorgehen konnte. Die erste war, dass man es den Stückwerktechnikern überlässt, immer weiter sozusagen an allen Schrauben zu drehen. Wäre man dadurch erfolgreich, dann würde die Wirtschaft kumulativ, sozusagen evolutiv wachsen. Aber man war damit nicht erfolgreich. Die zweite Möglichkeit war, ganz neue Grundlagen zu entwerfen. Erst dadurch schaffte die Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts den Durchbruch. Es war Thomas Kuhn, der diese diskontinuierliche bzw. revolutionäre Fortentwicklung der Wissenschaften eingehend untersucht hat. Bei den „wissenschaftlichen Revolutionen“, so seine Schlussfolgerung kommt es zum „Paradigmenwechsel“. Unter dem Paradigma verstand er ein in sich begrifflich und methodisch geschlossenes System der Wissenschaft, das die „Wissenschaftsgemeinde“ eine zeitlang für richtig hält. Das neue Paradigma bedeute aber nicht nur anders zu denken, sondern auch das Weltbild der Realität ändert sich nach einem Paradigmenwechsel vollständig. Kuhn schreibt:
„Unter der Führung eines neuen Paradigmas verwenden die Wissenschaftler neue Apparate und sehen sich nach neuen Dingen um. Und was noch wichtiger ist, während der Revolutionen sehen die Wissenschaftler neue und andere Dinge, wenn sie sich mit bekannten Apparaten an Stellen umsehen, die sie vorher schon einmal untersucht hatten. Es ist fast, als wäre die Fachgemeinschaft plötzlich auf einen anderen Planeten versetzt worden, wo vertraute Gegenstände in einem neuen Licht erscheinen und auch unbekannte sich hinzugesellen.“

Die Wandlung des Weltbildes nach dem Paradigmenwechsel lässt sich mit dem bekannten Beispiel aus der Astronomie, als die geozentrische Weltvorstellung durchdie heliozentrische ersetzt wurde, am eindrucksvollsten verdeutlichen: aus der schwimmenden Scheibe wurde ein schwebender Ball. Was in der Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts geschah, ist für den Laien schwieriger zu verstehen, aber auch er konnte gut ahnen, dass sich etwas auf eine sehr drastische Weise gewandelt hat. Auf einmal wurde über gekrümmten Raum und Reisen in der Zeit gesprochen, in dem Weltbild der klassischen Mechanik wäre so etwas ein sicheres Symptom eines schwersten psychischen Defektes im Kopf. Es ist offensichtlich, dass die alte und die neue Auffassung des Universums in der Physik nicht zueinander passen. Sie sind nicht „kommensurabel“, so dass nur eine dieser Auffassungen beibehalten werden konnte. Man kann ahnen, wie sich der damalige Mainstream gegen die neue Physik gewehrt hat. Aber trotz aller Widerstände, das alte Weltbild nach dem newtonschen partikel-mechanischen Modell war nicht mehr zu retten. Erst als dieses Modell geopfert wurde, war der Weg frei für die Mikro- und Makrophysik.
Der Paradigmenwechsel in der Physik war der sprichwörtliche Sargnagel für den Rationalismus vom Anfang der Moderne. Die Hoffnung, es gäbe nur eine richtige und damit universelle Denkweise bei allen Wissenschaften, mit der sich die richtige Bauweise oder Modell der Realität erforschen lässt, ist endgültig gestorben. Man kann sich zwar immer noch eine universelle wissenschaftliche Denkweise für die ganze Realität (Universum) vorstellen, wenn man sich aber den aktuellen Stand der Wissenschaften anschaut, lässt sich nichts anderes feststellen, als dass wir heute davon noch unendlich weit entfernt sind. Wir müssen uns also damit abfinden, dass jeder neue wissenschaftliche Durchbruch auch weiterhin nur ein neues Paradigma bedeuten wird, mit dem sich die Realität um eine Klasse besser erklären läßt, aber es wird immer noch ein unvollständiges und partielles Wissen bleiben.
Wenn wir diese Erfahrung auf die Wirtschaftwissenschaft übertragen, lässt sich nichts anderes folgern, als dass die ganze neoliberale Theorie, schon weil man mit ihr schon lange nichts erreichen konnte, ins Museum der Altertümer gehört, neben dem Spinnrad und der bronzenen Axt. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Wirtschaftswissenschaft, so wie sie sich seit mehr als zwei Jahrhunderte entwickelt hat, abgeschafft werden sollte. Natürlich gibt es dort viele „Teile“, die zu einem neuem Paradigma passen würden. In einem neuen Paradigma kann nicht alles neu sein, sie ist kein Anfang aus nichts. Das Alte wird jedoch anders strukturiert - es steht in einem anderen gedanklichen Kontext. Die Physik als Beispiel nehmend, formulierte der französischer Philosoph Gaston Bachelard, der sich vor allem mit Wissenschaftstheorie beschäftigte, das Verhältnis zwischen dem alten und neuen Paradigma wie folgt:
„Unterzieht man die epistemologischen Beziehungen zwischen der heutigen Physik und der newtonschen Wissenschaft einer allgemeinen Betrachtung, so sieht man, daß es keine »Entwicklung« von den alten zu den neuen Lehren gegeben hat, sondern gleichsam eine »Einwicklung« des alten Denkens durch das neue. Die Geistesgenerationen folgen einander wie Kästen, die andere Kästen umschließen. Zwischen dem nichtnewtonschen und dem newtonschen Denken besteht auch kein Widerspruch; ihr Verhältnis ist vielmehr durch eine Kontraktion gekennzeichnet.“

Wir können uns die „Einwicklung“ des alten in das neue Paradigma als Verhältnis zwischen dem Ganzen und seinen Teilen vorstellen, worüber wir schon einiges gesagt haben, als wir das Verhältnis zwischen der Mikroökonomik und Makroökonomik untersucht haben. Dort hat sich herausgestellt, dass das Ganze weder die Summe der Teile noch ein vergrößerter Teil ist. Mit den Beispielen aus der Chemie lässt sich dies besonders einfach verdeutlichen. Wenn wir zum Beispiel ein Wassermolekül zerlegen, kommt man zum Wasserstoff, aber der Wasserstoff und das Wasser haben kaum was gemeinsam. Das Wasserstoffatom ist sozusagen „eingewickelt“ (Bachelard) in dem Molekül des Wassers. Wir können zum Wasserstoffatom durch „Kontraktion“ (Bachelard) bzw. durch Zerschlagung des Wassermoleküls wieder gelangen, aber dann haben wir kein Wasser mehr. Zwischen dem Element Wasserstoff (H2) und dem Wasser (H2O) liegen Welten und es gibt keinen logisch zwingenden Weg von einem zum anderen. Mit den Beispielen aus der Chemie lässt sich dies besonders einfach verdeutlichen. Wenn wir zum Beispiel ein Wassermolekül zerlegen, kommt man zum Wasserstoff, aber der Wasserstoff und das Wasser haben kaum was gemeinsam. Das Wasserstoffatom ist sozusagen „eingewickelt“ (Bachelard) in dem Molekül des Wassers. Wir können zum Wasserstoffatom durch „Kontraktion“ (Bachelard) bzw. durch Zerschlagung des Wassermoleküls wieder gelangen, aber dann haben wir kein Wasser mehr. Zwischen dem Element Wasserstoff (H2) und dem Wasser (H2O) liegen Welten und es gibt keinen logisch zwingenden Weg von einem zum anderen.
Wir wollen uns aber in diese Problematik nicht weiter vertiefen. Uns ging es an dieser Stelle nur darum, in Erinnerung zu rufen, dass in den erfolgreichen, den sogenannten „harten“ Wissenschaften der Paradigmenwechsel ein schon längst anerkannter Weg des wissenschaftlichen Fortschritts ist, möge man sich in den „weichen“ Wissenschaften auch noch so dagegen sträuben. Die Leser, die an allgemeinen erkenntnistheoretischen Überlegungen zu diesem Themen interessiert sind, können sich noch den zweiten und den dritten Teil dieses Beitrags anschauen:
Teil 2: Wissenschaftliche Revolution versus „normale“ Wissenschaft
Teil 3: Die Irrtümer der Nachbesserer und Weiterentwickler von Theorien
Die Paradigmen der Wirtschaftswissenschaft: Ein grober überblick
Heben wir noch einmal ausdrücklich hervor, dass die Verfechter der neoliberalen Theorie bzw. des Paradigmas von der revolutionären Auffassung des wissenschaftlichen Fortschritts nichts wissen wollen. Sie sind überzeugt - oder sie wollen es uns zumindest einreden -, dass nach ihrer Theorie nichts anderes kommen kann und wird. Abgesehen einmal von kleineren Nachbesserungen, sollte die neoliberale Theorie die letzte Entwicklungsstufe der Wirtschaftswissenschaft bedeuten. Zugleich stellen sie das Modell von Walras (und Pareto) als eine kontinuierliche Weiterentwicklung der frühliberalen Theorie vor. Damit wird nahegelegt, dass es in der „seriösen“ Wirtschaftswissenschaft eigentlich nie einen Paradigmenwechsel gab. Das stimmt aber nicht. Auch die Wirtschaftswissenschaft zeigt eine diskontinuierliche oder revolutionäre Fortentwicklung, wie es in dem nächsten Bild grob dargestellt ist.
| |
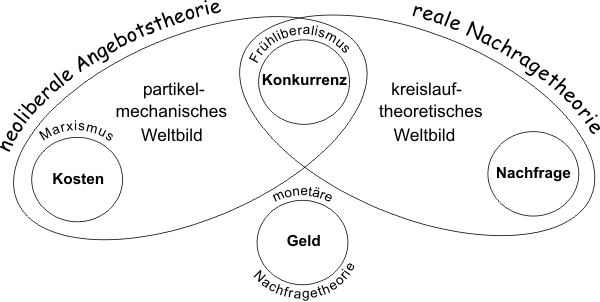 |
Wir werden im nächsten Beitrag etwas mehr über das neoliberale Paradigma sagen, weil es heute das Paradigma des ökonomischen Mainstream ist. Uns wird es aber diesmal nicht um die Kritik der neoliberalen Theorie gehen, sonder wir wollen herausfinden, woran es liegt, dass sie über Ungleichgewicht, Nachfragemangel und schließlich über die periodischen Krisen der Marktwirtschaft nichts sagen kann. Im Anschluss werden wir dann zeigen, dass die reale Nachfragetheorie die Lösung ist, die als solche ein neues Paradigma darstellt. Zur Vervollständigung unserer erkenntnistheoretischen Überlegungen über den Paradigmenwechsel ist es angebracht, auch über die anderen Paradigmen der Wirtschaftswissenschaft ein paar Worte zu verlieren.
Frühliberalismus: Am Anfang der Wirtschaftswissenschaft, damals wurde sie noch Politische Ökonomie genannt, stand die Idee eines Marktes. Die Absicht der Frühliberalen war es, allen Mitgliedern der Gesellschaft möglichst viele Chancen zu geben, Güter und Dienste anzubieten und nachzufragen. Die freie Konkurrenz sollte dann dafür sorgen, dass sich die preisgünstigeren Anbieter durchsetzen, was die Effizienz der Wirtschaft erhöhen und den Erfolg belohnen würde. Die ganze Argumentation der Frühliberalen war moraltheoretisch und machttheoretisch. Sie war revolutionär in dem Sinne, dass sie von einer negativen Anthropologie ausging und bestrebt war, die hierarchische (gesteuerte) Wirtschaft und Gesellschaftsordnung mit einer dezentralen (geregelten) Ordnung zu ersetzen. Diese dezentrale Ordnung, das „System der natürlichen Freiheit“ (Adam Smith), sollte auf der Konkurrenz beruhen, weil man sich von ihr die „Entmachtung“ aller bisherigen Machtstrukturen erhofft hat, wie es viel später Alexander Rüstow trefflich formulierte.
Bei dem Frühliberalismus hat es sich wahrhaftig um ein neues Paradigma in den Geisteswissenschaften gehandelt. Die letzteren beiden Theorien, den Marxismus und den Keynesianismus kann man im strengen Sinne des Wortes nicht als Paradigmen bezeichnen, aber weil die Wirtschaftswissenschaft „weich“ ist, in einem „weichen“ Sinne lassen wir es hier trotzdem gelten, dass sie doch Paradigmen sind.
Marxismus: Schon lange vor Marx waren die Ökonomen auf der Suche nach der Formel, wie sich der sogenannte Wert, also der echte und gerechte Preis der Güter bestimmen lässt. Marx meinte, er habe den Wert gefunden, so dass man den Markt bzw. die Konkurrenz nicht mehr für die Preisbestimmung brauchen würde. Die die von ihm vorgeschlagene Kostenrechnung („Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“) sollte sich dann auf eine reine administrative bzw. technische Angelegenheit - eine Routinearbeit - reduzieren.
Dies würde das Wirtschaften in der Tat erheblich vereinfachen. Die Wirtschaftsakteure müssten sich dann nur verständigen können, wer, was und in welchen Mengen es produziert werden sollte. Dann würde es keine Disproportionalitäten geben, die nach Marx die wahre Ursache der periodischen Krisen des Kapitalismus wären. Folglich hat sich Marx die kommunistische Wirtschaft als eine Verwirklichung von Laissez-faire vorgestellt, natürlich mit vergesellschaftlichten Produktionsmitteln. In der Praxis stellte sich sehr schnell heraus, dass die Marxsche Formel für die „objektive“ Kosten- und Preisbestimmung nicht taugt. Überlässt man es nämlich den produzierenden Betrieben, frei die Preise zu bestimmen bzw. die Kosten zu berechnen, würden sie nur in einer Hinsicht sehr innovativ sein: neue Kosten zu erfinden, anstatt die bestehenden zu verringern. Schließlich wurde die staatlich geplante Kommandowirtschaft die einzige Möglichkeit, eine Wirtschaft ohne Markt und Konkurrenz zu realisieren. Sie konnte die Disproportionalitäten der freien Marktwirtschaft beseitigen, sie war aber unfähig die Produktivität zu steigern.
Die klassische oder monetäre Nachfragetheorie: In der klassischen liberalen Theorie und bei Marx spielt das Geld eine geringe Rolle, in der neoliberalen gar keine. Folglich konnte auch die Geldhortung kein Thema sein. Es waren nur wenige Ökonomen, die am Anfang des 19. Jahrhundert in der Geldhortung ein Problem sahen. Zu den wichtigsten Namen gehören Sismondi und Malthus, die man als Begründer der Nachfragetheorie bezeichnen kann. Sie waren aber ziemlich erfolglos. Ein Durchbruch für eine auf dem Geld bzw. der Geldhortung begründete Nachfragetheorie ist erst Keynes am Anfang des 20. Jahrhunderts gelungen. Aber auch sein Erfolg war kurzlebig. Die monetäre Nachfragetheorie konnte nie erklären, wo das „Geld begraben ist“, und sie war theoretisch sehr „dünn“. Ihr fehlten feste analytische Grundlagen.
Nebenbei kann noch angemerkt werden, dass der Versuch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, das Spiel zum neuen Paradigma zu statuieren, als gescheitert zu betrachten ist, so dass wir dieses Paradigma nicht ins Bild aufgenommen haben.
zu Teil 2 
|
|
|
| |
|
|
|
|